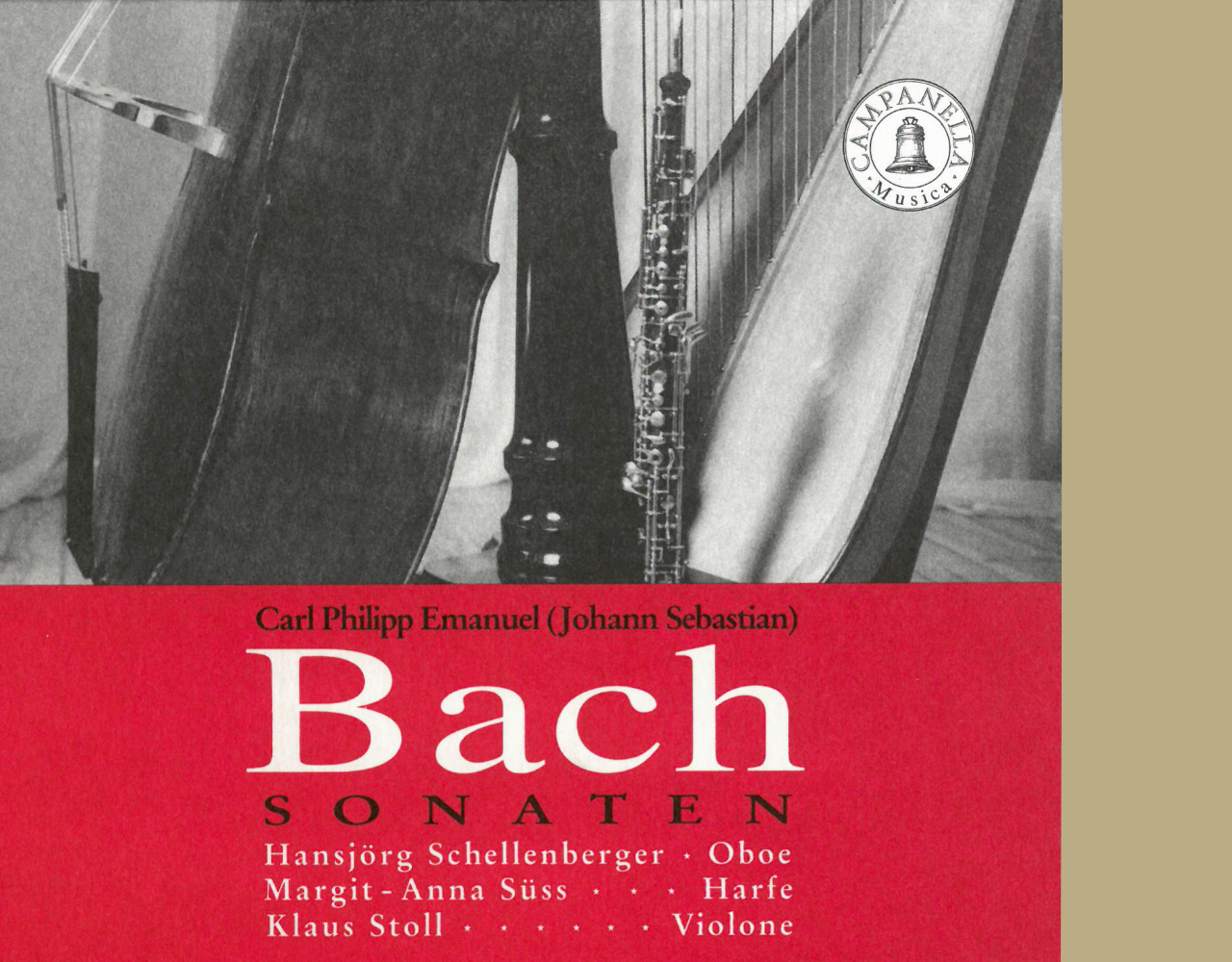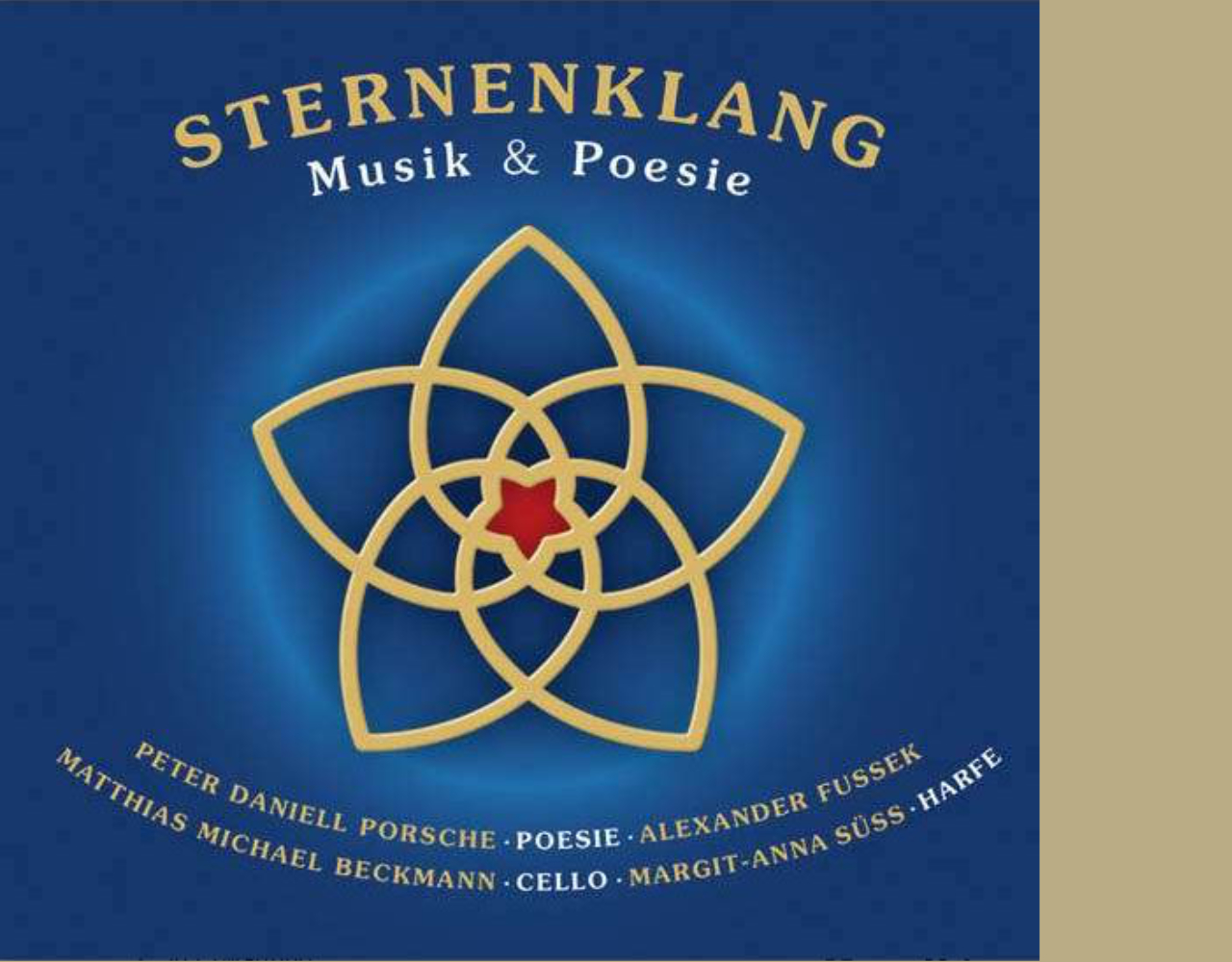
Sternenklang I
9. Februar 2022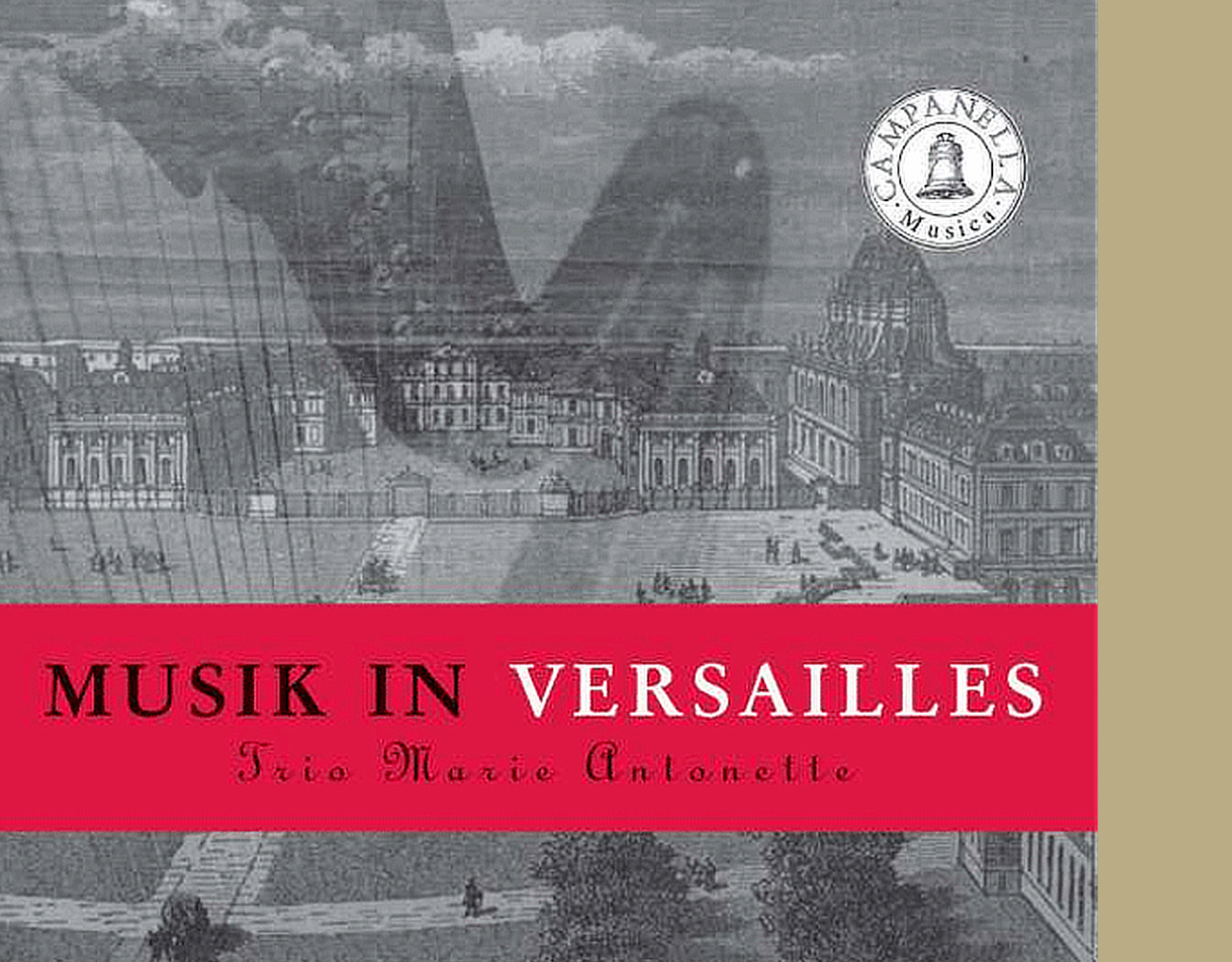
Musique à Versailles
13. Februar 2022Vater oder Sohn? Sonaten von Bach
Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war es durchaus üblich, wenn nicht gar die Norm, daß Flötisten auch die Oboe und Oboisten die Flöte beherrschten – zumindest, wenn sie als Berufsmusiker im Orchester saßen. Eine Persönlichkeit wie der Preußenkönig Friedrich II. (»der Große«) hatte es natürlich nicht nötig, sich beider Instrumente zu befleißigen: Seine Komponisten konnten sich vorwiegend auf die Lieferung von Stücken für die Traversflöte beschränken, die Seine Majestät mit Vorliebe zu blasen beliebten. So kam es denn auch, daß Johann Sebastian Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel in seiner Zeit am Hofe des »Alten Fritz« bis hin zum anspruchsvollen Solo in a-moll vieles für die Flöte verfaßte, das eine rechte Spielkunst verlangt(e), ohne daß einzusehen wäre, warum dieselben Partien nicht auch auf der Oboe wirken könnten …
… und angesichts der Tatsache, daß Carl Philipp Emanuel Bach auch die hier aufgenommene Solosonate für Harfe geschrieben hat, darf man ohne weiteres riskieren, die gewohnte Continuo-Gruppe durch eine etwas extravagantere Formation zu ersetzen: An die Stelle des Cembalos tritt also die Harfe, und das Violoncello wird durch einen Violone abgelöst – mit überaus aparten und delikaten Konsequenzen. Die Frage der Authentizität, die sich der eine oder andere Kenner oder Liebhaber der Musik womöglich stellen könnte, ist schnell vom Tisch. Erstens waren ein relativ freizügiger Umgang mit verfügbarem Instrumentarium zu Zeiten der Bachs an der Tagesordnung, und zweitens sind die drei Flötensonaten, die als BWV 1020, 1031 und 1033 gehandelt werden, nach heutigen Erkenntnisse mitnichten dem großen Leipziger Thomaskantor, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit demselben CPE Bach zu verdanken, der am Hofe des preußischen Königs demselben mancherlei Flötentöne darbrachte.
… und angesichts der Tatsache, daß Carl Philipp Emanuel Bach auch die hier aufgenommene Solosonate für Harfe geschrieben hat, darf man ohne weiteres riskieren, die gewohnte Continuo-Gruppe durch eine etwas extravagantere Formation zu ersetzen: An die Stelle des Cembalos tritt also die Harfe, und das Violoncello wird durch einen Violone abgelöst – mit überaus aparten und delikaten Konsequenzen. Die Frage der Authentizität, die sich der eine oder andere Kenner oder Liebhaber der Musik womöglich stellen könnte, ist schnell vom Tisch. Erstens waren ein relativ freizügiger Umgang mit verfügbarem Instrumentarium zu Zeiten der Bachs an der Tagesordnung, und zweitens sind die drei Flötensonaten, die als BWV 1020, 1031 und 1033 gehandelt werden, nach heutigen Erkenntnisse mitnichten dem großen Leipziger Thomaskantor, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit demselben CPE Bach zu verdanken, der am Hofe des preußischen Königs demselben mancherlei Flötentöne darbrachte.
Weitere Informationen
Tracklisting
Johann Sebastian Bach (zugeschrieben)
Sonate für Flöte und Basso continuo C-Dur BWV 1033
01 1. Andante – Presto
02 2. Allegro
03 3. Adagio
04 4. Menuett I und II
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonate für Harfe solo G-Dur Wq 139 (H 563)
05 1. Adagio un poco
06 2. Allegro
07 3. Allegro
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonate für Oboe und Basso continuo g-moll Wq 135 (H 549)
08 1. Adagio
09 2. Allegro
10 3. Vivace
Johann Sebastian Bach (zugeschrieben)
Sonate für Flöte und Cembalo Es-Dur BWV 1031
11 1. Allegro moderato
12 2. Siciliana
13 3. Allegro
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonate für Flöte solo a-moll Wq 132 (H 562)
14 1. Poco Adagio
15 2. Allegro
16 3. Allegro
Johann Sebastian Bach (zugeschrieben)
Sonate für Violine und Basso Continuo g-Moll BWV 1020
17 1. Allegro
18 2. Adagio
19 3. Allegro
TT 63:51
Künstler
Hansjörg Schellenberger, Oboe
Margit-Anna Süß, Harfe
Klaus Stoll, Violone
Pressestimmen
☞ »Die Sonaten von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach kommen dank des traumwandlerisch sicher korrespondierenden Ehepaares Margit-Anna Süß (Harfe) und Hansjörg Schellenberger ebenso artistisch wie elegant herüber.« Berliner Tagesspiegel, 12. August 1999
☞»Besonders erhellend ist das Bach-Programm, denn die Besetzung mit Oboe, Harfe und Violone und eine eher moderne Aufführungspraxis verleihen der Musik eine überraschende Eleganz.« Fono Forum, 10/1999
☞ »… die Klangmischung von Oboe und Harfe scheinen in diesen Stücken wirklich wie aus einer anderen Welt zu kommen: edler Wohlklang und schmeichelhafte Geschmeidigkeit der sich rauschhaft verschränkenden Klangvaleurs rühren ans Herz – die kongeniale Übereinstimmung der Instrumentenpartner ist faszinierend …« ‘rohrblatt, Heft 4/2000